Aktuelles

Gehalts-Check für GmbH-Geschäftsführer
Alljährlich veröffentlicht die BBE media eine Studie zu den Geschäftsführer-Vergütungen in der deutschen Wirtschaft. Aufgeteilt nach Wirtschaftszweigen und Branchen finden (Gesellschafter-)Geschäftsführer hier belastbare Informationen für die Anpassung ihrer ihrer Vergütung – also aller Bestandteile wie […]
Recht & Steuern

Das neue Register für Gesellschaften bürgerlichen Rechts: Handlungsbedarf für GmbH-Geschäftsführer?
Am 1. Januar 2024 ist das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts – kurz MoPeG – in Kraft getreten. Es bringt wesentliche Neuerungen im Recht der Personenhandelsgesellschaften, vor allem aber für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Für […]

Firmenwagen: Anforderungen an ein EDV-gestütztes Fahrtenbuch
Wird ein Firmenwagen auch für private Fahrten genutzt, ist der Wert der privaten Nutzung als Entnahme dem Gewinn hinzuzurechnen. Dieser Wert kann anhand der 1-Prozent-Regelung oder mittels eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs ermittelt werden. Ein Fahrtenbuch ist […]

Energiepreispauschale (2): Besteuerung verfassungswidrig?
Im Jahr 2022 war die Energiepreispauschale (EPP) in aller Munde. Bereits damals hagelte es Kritik mit Blick auf die Besteuerung dieser Entlastungsmaßnahme. Nun prüft das Finanzgericht Münster die Rechtmäßigkeit der Besteuerung. Ab September 2022 wurde […]

Energiepreispauschale (1): Für Streitigkeiten sind die Finanzgerichte zuständig
Haben Arbeitnehmer einen Anspruch gegen ihren Arbeitgeber auf Zahlung der Energiepreispauschale von 300 Euro und – wenn ja – vor welchem Gericht ist der Anspruch einzuklagen? Mit diesen Fragen hatte sich das Landesarbeitsgericht Düsseldorf in […]

GmbH-Geschäftsführer mit Dienstwagen: Die heimische Garage als Steuersparinstrument
Der BFH weist in seinem Urteil vom 4. Juli 2023 (Az. VIII R 29/20) den Weg, wie GmbH-Geschäftsführer den geldwerten Vorteil aus der Privatnutzung ihres Dienstwagens – und damit die darauf entfallende Lohnsteuer – mindern […]
Finanzierung & Geldanlage

Risikoprävention: Multiple Krisen schlagen durch
InterviewDie Zahl der Unternehmensinsolvenzen nahm 2023 erheblich zu. Nun kommt es verstärkt auf Risikoprävention an. Was Unternehmen nun tun sollten – darüber sprachen wir mit Jörg Rossen, Geschäftsführer der Creditreform Bonn Trier Rossen Eberhard GmbH […]

Lebenselixier Liquidität: Die Macht von Forderungsmanagement und Factoring
In der Welt des Unternehmertums und der Wirtschaft ist Liquidität ein zentraler Aspekt, der oft den Unterschied zwischen dem Bestehen und dem Scheitern eines Unternehmens ausmacht. Liquidität wird oft als das Lebenselixier eines Unternehmens bezeichnet […]

Im Auslandsgeschäft Risiken reduzieren
Kriege, Protektionismus, Angriffe auf Frachtschiffe – im Welthandel geht es gerade äußerst ungemütlich zu. Dennoch können Firmen im Auslandsgeschäft einige Risiken reduzieren. Bei den „Internationalen Aktionswochen“ der Sparkasse KölnBonn erfahren Sie dazu alles Wichtige. Der […]

Forderungsmanagement: Steigender Druck auf die Stabilität der Unternehmen
Die Krisenzeichen nehmen zu: Die Zahlungsverzugsdauer hat sich erhöht, auch melden wieder deutlich mehr Unternehmen Insolvenz an. Die Liquidität der Betriebe ist von mehreren Seiten bedroht. Umso mehr kommt es jetzt auf ein konsequentes Forderungsmanagement […]

Transformation: Die Herausforderung gemeinsam meistern
Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, müssen auch die Unternehmen nachhaltiger werden. Vor allem für kleinere Betriebe ist das eine große Herausforderung. Die Sparkasse KölnBonn begleitet sie bei dieser Transformation. Der Wandel zu mehr ökologischer, sozialer […]
Management & Controlling

Vom Empfangsbereich bis zum Konferenzraum: Tipps für eine professionelle und einladende Büroeinrichtung
Die Büroeinrichtung erstreckt sich über den gesamten Raum und prägt maßgeblich das Ambiente und die Arbeitsatmosphäre. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung von Produktivität und Wohlbefinden der Mitarbeiter. Von ergonomischen Möbeln im Empfangsbereich […]

Berichtspflicht auch für mittelständische Unternehmen: Wie Unternehmen beim ESG-Reporting den Aufwand möglichst gering halten
Dass Unternehmen nachhaltig wirtschaften, wird immer häufiger von Investoren und Kunden verlangt. Doch das ESG-Reporting wird auch noch aus einem anderen Grund für immer mehr Unternehmen relevant. Denn die Berichtspflicht wird ab 2025 auf mittelständische […]

Energieeffizienz in der Industrie 4.0: Wie digitale Transformation die Nachhaltigkeit fördert
Im Zeitalter der Industrie 4.0 wird die digitale Transformation nicht nur als ein Weg zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung gesehen, sondern auch als ein entscheidender Faktor zur Förderung der Nachhaltigkeit in der industriellen Produktion. Die Integration […]
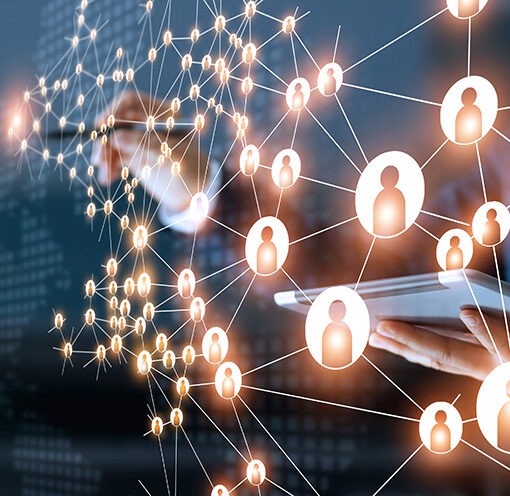
Kunden, Mitarbeiter und Partner gewinnen: So machen Sie sich zum Knoten aller Netzwerke
Erfolgreiche Unternehmer verfügen oft über zahlreiche Kontakte zu anderen Firmen, Geschäftspartnern oder Medien, die sie unterstützen oder bei denen sie Informationen und Hilfe erhalten. Aber lohnt sich ein solches Netzwerk? Wie baut man es auf? […]

Mitten im Sturm robust bleiben: Wie GmbHs Krisen erfolgreich meistern
Für GmbHs gilt es aktuell mehr denn je, Lösungsansätze für die schwierige wirtschaftliche Gesamtlage zu finden und die Aufmerksamkeit auf jene Stellschrauben zu richten, die in ihrem Einflussbereich liegen, um drohende Krisen zu meistern. Im […]
Digitalisierung

Energieeffizienz in der Industrie 4.0: Wie digitale Transformation die Nachhaltigkeit fördert
Im Zeitalter der Industrie 4.0 wird die digitale Transformation nicht nur als ein Weg zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung gesehen, sondern auch als ein entscheidender Faktor zur Förderung der Nachhaltigkeit in der industriellen Produktion. Die Integration […]

Die Zukunft des E-Commerce: Warum Shop Pay für jeden Online-Shop, der skalieren will, unverzichtbar ist
In der dynamischen Welt des Online-Handels ist es für Unternehmen essentiell, mit den neuesten Technologien Schritt zu halten, um ihre Wachstumsziele zu erreichen. Der E-Commerce-Sektor erlebt eine stetige Evolution, getrieben durch Innovationen, die sowohl die […]

Cybersicherheit: Wie kleine und mittlere Unternehmen Cyberattacken vorbeugen können
Berichte über Cyberangriffe sind heutzutage keine Seltenheit mehr. Die Berichte der Medien greifen dabei meistens umfangreiche Attacken auf, die Verwaltungsorgane, Hochschulen oder große Firmen treffen. Ein Beispiel ist die Cyberattacke, die Anfang November dieses Jahres […]

Arbeitsequipment schützen und Ausgaben reduzieren
Viele Arbeitgeber investieren jedes Jahr hohe Summen, um ihre Mitarbeiter mit Diensthandys, Laptops und Tablets auszustatten. Und es ist ärgerlich, wenn die teure Technik beschädigt wird. Um das zu verhindern, gibt es inzwischen zahlreiche Produkte, […]

Kundenbetreuung jenseits des Telefons: Innovative Kommunikationswege, die man kennen sollte
(advertorial) Kunden erwarten heute mehr, wenn es um die Kundenbetreuung geht; sie suchen nach einer Kommunikation, die sowohl persönlich als auch effizient ist. In diesem Artikel werden innovative Kommunikationswege vorgestellt, die über das traditionelle Telefonat […]
Personal & Weiterbildung

Mitarbeiterführung: Warum modernes Leadership ohne Autorität nicht funktionieren kann
Um Fachkräfte zu halten, setzen immer mehr Unternehmen auf moderne Führung, die Mitarbeitern viele Freiheiten zugesteht. In der Praxis ist dieser Ansatz jedoch oft zum Scheitern verurteilt. Viele Führungskräfte sind überfordert und klagen über Mitarbeiter, […]

Von innen heraus wachsen: Wie interne Entwicklung das Engagement steigert
Die heutige Geschäftswelt setzt zunehmend auf Unternehmen und eine Unternehmenskultur, die kontinuierliches Wachstums und ständige Verbesserung fördern. Doch wie erreichen Sie dieses Ziel effektiv? Eine vielversprechende Strategie besteht darin, das Wachstum von innen heraus zu […]

Mehr als Mitarbeitergewinnung: Stellenausschreibungen als Spiegelbild der Unternehmensidentität
Bei der Betrachtung einer Stellenausschreibung geht es um wesentlich mehr als die bloße Aufzählung zu besetzender Positionen. Vielmehr stellt sie das unmittelbare Aushängeschild eines Unternehmens dar und spiegelt dessen Identität wider. Für potenzielle Bewerber ist […]

Anerkennung und Belohnung: So steigert man die Motivation im Team
Anerkennung und Belohnung spielen eine zentrale Rolle bei der Steigerung der Motivation und Zufriedenheit in Teams. Sie sind nicht nur Ausdruck von Wertschätzung, sondern stärken auch das Engagement und die Bindung der Mitarbeiter an das […]

Core Values: Ein Muss für KMU
In Deutschland steht uns bis 2030 eine Lücke von etwa vier Millionen Fachkräften bevor, während auch in der Schweiz und Österreich jeweils rund 600.000 Arbeitskräfte fehlen werden. Doch das, was wir heute beobachten, ist lediglich […]
Nachhaltigkeit

Die Märkte der Zukunft: Wie Unternehmen die Zukunft verstehen und gestalten
Eine Welt, in der wir gerne leben, wird von Menschen gemacht, denen eine gute Zukunft am Herzen liegt. Für den, der mit wachsamem Optimismus an die Zukunft herantritt, bietet sie schier unendlich viele Gelegenheiten, mehr […]

Energieeffizienz in der Industrie 4.0: Wie digitale Transformation die Nachhaltigkeit fördert
Im Zeitalter der Industrie 4.0 wird die digitale Transformation nicht nur als ein Weg zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung gesehen, sondern auch als ein entscheidender Faktor zur Förderung der Nachhaltigkeit in der industriellen Produktion. Die Integration […]

Unternehmenswerte: Die neun Spielregeln nachhaltiger Innovation
Scheininnovationen und überstürzte Veränderungen schaden meist mehr als sie nützen. Sie untergraben die Zukunftsfähigkeit des Unternehmertums, das Vertrauen in eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft und führen nicht selten zum Untergang von Unternehmen. Darüber hinaus führen uns der […]

Nachhaltige Wirtschaftspolitik ist eine Herausforderung für deutsche KMU
Die kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) sind eine der tragenden Säulen der deutschen Wirtschaft. Momentan leiden sie besonders unter den mannigfaltigen Problemen in diesem Bereich. Ob Fachkräftemangel, Energiepreise oder Ressourcenmangel: Der Druck steigt und viele […]

Geschäftsreisen nachhaltig gestalten
Reisen gehören zum Alltag vieler Geschäftsführer fest dazu: Beziehungen zu Geschäftspartnern und Kunden müssen auch beim persönlichen Besuch gepflegt werden. Messen und andere Netzwerkveranstaltungen sind wichtige Gelegenheiten, neue Kontakte zu knüpfen und sich weiterzubilden. Ohne […]
Marketing & Vertrieb

Vertrauen als Währung: Wie die Reputation den Unternehmenswert steigert
Vertrauen ist der Schlüssel zum Erfolg. Deshalb hat das öffentliche Ansehen eines Unternehmens erheblichen Einfluss auf seinen tatsächlichen Wert. Die Reputation ist jedoch kein Zufallsprodukt, sondern lässt sich gezielt stärken. Die Reputation eines Unternehmens ist […]

Ergonomie und Design: Wie Sie Ihre Markenpräsenz auf Büro- und Messeflächen stärken
Visuelle Ästhetik und das Nutzererlebnis nehmen einen immer größeren Stellenwert ein, wenn es um die eigene Marke und Präsenz geht. Deshalb sind Ergonomie und Design entscheidend für den Aufbau einer starken Markenpräsenz auf Büro- und […]

Effektive Werbung und Markenpräsenz für Unternehmen: Strategien, die Aufmerksamkeit erregen
Die heutige Geschäftswelt ist so wettbewerbsintensive wie noch nie zuvor und effektive Werbung und starke Markenpräsenz sind für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, in einer Welt, die von Informationen überflutet ist, […]

Maßnahmen im B2B-Marketing: 2024 mehr Umsatz erzielen
Wenn Umsatzziele nicht erreicht werden, rechtfertigen sich Angestellte gegenüber ihren Vertriebsleitern regelmäßig mit der aktuellen Marktsituation, die einen Erfolg unmöglich mache. Tatsächlich wissen viele Verkäufer jedoch schlichtweg nicht, wo sie den Hebel ansetzen können, um […]

Digitale Zahlung im stationären Handel neu denken
Zahlungsarten wie Bargeld, Kreditkarte oder digitales Wallet sind im stationären Handel bekannt. Doch oft fehlt die Flexibilität und der Kunde hat zu wenig Auswahl. Ein digitales Bezahlsystem kann das ändern: Der Kunde scannt dafür einen […]
Versicherung & Vorsorge

Ergonomie und Sicherheit: Die Rolle von maßgeschneiderter Arbeitskleidung in der Prävention von Verletzungen
Die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von größter Bedeutung für den reibungslosen Betrieb Ihres Unternehmens. In diesem Zusammenhang spielt die richtige Arbeitskleidung eine entscheidende Rolle, insbesondere wenn es um die Prävention von […]

Emotionale Intelligenz: Fünf Gründe warum es Sinn macht, auf unsere Emotionen zu hören
Was verbirgt sich hinter dem seit 2000 recht geläufigen Begriff „emotionale Intelligenz“ oder kurz EQ? Es gibt dazu spannende Erkenntnisse: 75 Prozent der untersuchten Menschen mit durchschnittlichem Intelligenzquotient (IQ) erreichen proportional höhere Leistungen als Menschen […]

Moderne Risiken, ihr Management und der Versicherungsmarkt
Die vergangenen Jahre haben noch einmal deutlich vor Augen geführt, wie vernetzt unsere heutige Lebenswelt ist. Als 2021 das Containerschiff „Ever Given“ den Suez-Kanal blockierte, verzögerte das zahlreiche Lieferungen im eng getakteten Welthandel. Die Folge […]

7 Tipps um als (Klein-)Unternehmer die richtige Versicherung zu finden
Die Wahl der richtigen Versicherungen kann eine schwierige Aufgabe sein. Das Angebot ist riesig und es ist nicht ohne weiteres ersichtlich, welche Versicherung man unbedingt benötigt und welche nur ein hilfreiches Extra ist. Vor allem […]

Betriebliche Altersversorgung: Lösungen für Gründer, Gesellschafter und Geschäftsführer
Spätestens bei der Einstellung der ersten Mitarbeiter werden auch Unternehmensgründer mit dem Thema „betriebliche Altersversorgung” (bAV) konfrontiert. Denn jede abhängig beschäftigte Person hat nach den Bestimmungen des § 1a Betriebsrentengesetz einen Anspruch auf die Einrichtung […]









